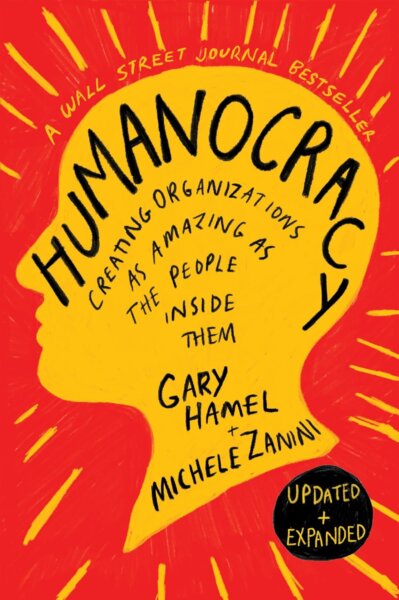 Viele Unternehmen nehmen es als gegeben hin: Wächst eine Organisation, wächst auch die Bürokratie. Management-Professor Gary Hamel und Michele Zanini widersprechen dem entschieden. In ihrem Buch Humanocracy (auf englisch, auf deutsch) fordern sie Alternativen und zeigen, dass man sich mit Bürokratie nicht abfinden muss:
Viele Unternehmen nehmen es als gegeben hin: Wächst eine Organisation, wächst auch die Bürokratie. Management-Professor Gary Hamel und Michele Zanini widersprechen dem entschieden. In ihrem Buch Humanocracy (auf englisch, auf deutsch) fordern sie Alternativen und zeigen, dass man sich mit Bürokratie nicht abfinden muss:
„Defenders of the status quo will tell you that bureaucracy is the inevitable correlate of complexity, but our evidence suggests otherwise. The vanguard companies prove that it’s possible to build organizations that are big and fast, disciplined and empowering, efficient and entrepreneurial, and bold and prudent.“
Potenziale wirksam einbringen können
Sie zeigen Wege, wie Organisationen Strukturen behalten und gleichzeitig lähmende Bürokratie abbauen können. Bürokratie mache Menschen unflexibel, apathisch und im besten Fall mittelmäßig. Selbst wenn man Menschen nur als Ressource betrachtet, wird die Frage relevant: Wenn die Ressource Mensch schwach performt, leidet die Organisation und damit ihre Überlebensfähigkeit. Könnten Menschen ihre Potenziale besser einbringen dann steigt die Leistungs und damit die Überlebensfähigkeit der Organisation.
Genau deshalb leitet die Autoren eine andere Kernfrage:
“The question at the core of bureaucracy is, ‘How do we get human beings to better serve the organization?’ The question at the heart of humanocracy is, ‘What sort of organization elicits and merits the best that human beings can give?’ As we’ll see, the implications of this shift in perspective are profound.”
Es geht also darum, wie post-bürokratische Organisationen aussehen können. Hamel und Zanini illustrieren das mit Beispielen aus Pionier-Unternehmen, in denen Menschen deutlich mehr von ihrem Können einbringen und ihre Potenziale besser entfalten können.
Prinzipien für andere Organisationen
Daraus leiten sie Prinzipien ab, die jeder Organisation als Orientierung dienen können:
- Experimente wagen und in Experimenten denken.
- Verantwortung ermöglichen.
- Interne Märkte etablieren, eine Idee, die schon in den 1980er-Jahren aufkam.
- Meritokratie stärken, also Leistung belohnen anstelle von Betriebszugehörigkeit.
Als Organisationsberater, der mit einer systemtheoretischen Brille auf Organisationen blickt, fällt mir auf, dass es keine konsistente Theorie gibt, mit der die beiden Autoren argumentieren. Dazu kommt eine normative Argumentation (A ist grundsätzlich besser als B). Das ist ungünstig, um Organisationen dabei zu unterstützen, sich erfolgreicher zu regulieren. Denn es macht für manche Alternativen blind.
Trotzdem bleibt die Grundfrage relevant: Wie schaffen wir Organisationen, in denen Menschen ihr Potenzial besser entfalten können? Die Beispiele im Buch liefern viele Anregungen, solche Elemente bewusst im eigenen Kontext auszuprobieren.


