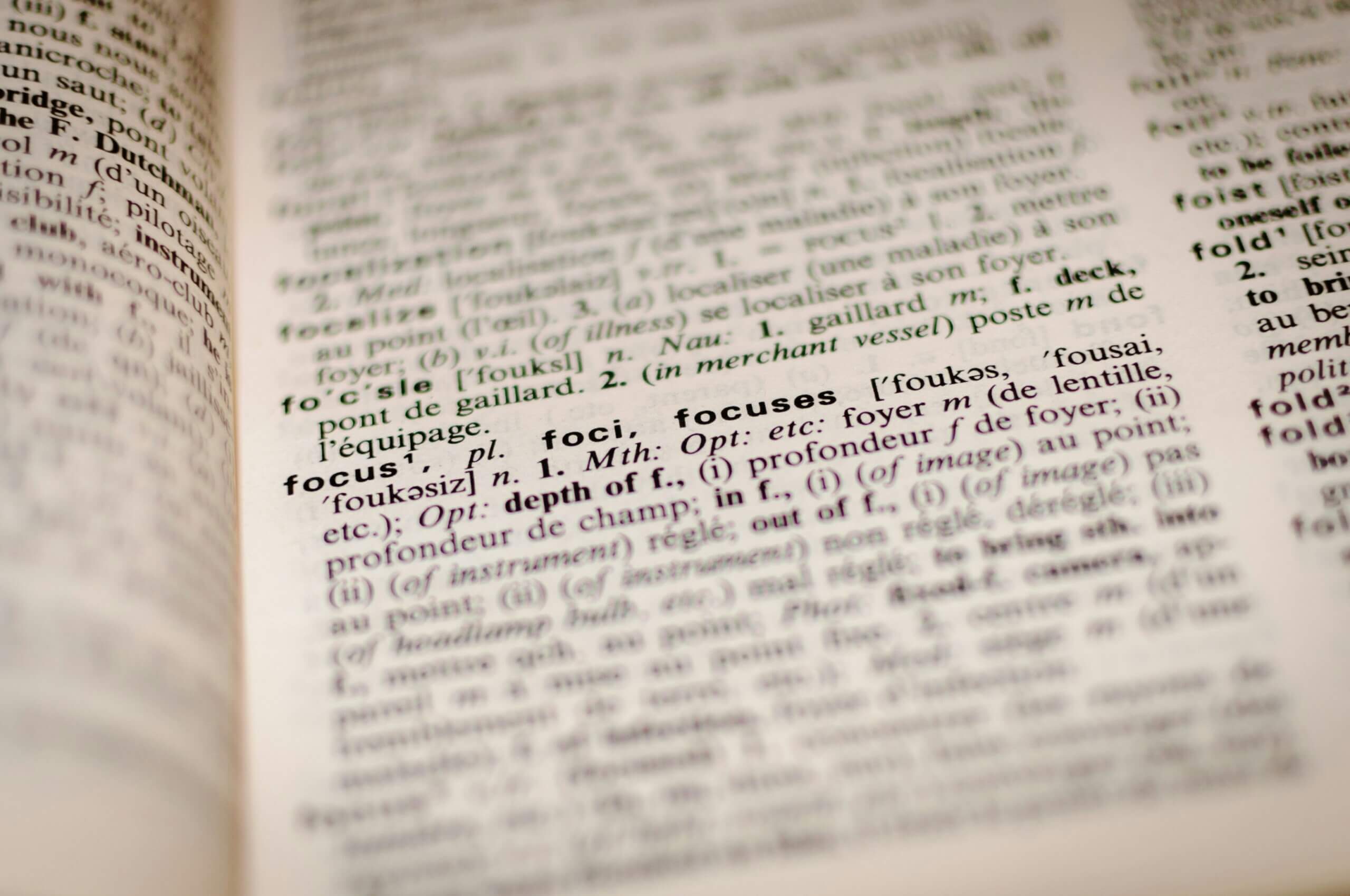Eine Analyse zur strategischen Integration von KI in Unternehmen
Geschrieben von Stefan Palkoska und Florian Rustler.
Künstliche Intelligenz ist nicht einfach ein weiteres Tool im IT-Werkzeugkasten. Sie ist ein Umbruch, der Geschäftsmodelle, Arbeitsweisen und ganze Branchen verändern wird. Die Frage ist nicht, ob die Veränderungen kommen wird, sondern wie gut Sie vorbereitet sind.
Algorithmen und Daten sind wichtig, aber der eigentliche Hebel und die eigentliche Arbeit liegt in der Organisation selbst. In Strukturen, Entscheidungswegen und der Art, wie Menschen zusammenarbeiten.
Warum überhaupt KI?
Unternehmen, die KI einsetzen, verfolgen im Kern drei Ziele:
- Markteinführungszeiten verkürzen
- Ressourcen effizienter nutzen
- Mehr Kapazität für Innovation schaffen
Schauen wir uns diese drei Stoßrichtungen genauer an.

Quelle: Unsplash
KI Use-Case 1: Schneller auf den Markt – Time-to-Market verkürzen
Bei der Beschleunigung der Entwicklung kommt KI vor allem dort zum Einsatz, wo bislang lineare, weitgehend manuelle Entscheidungs- und Designprozesse dominiert haben. Ein prägnantes Beispiel ist die Anwendung KI-gestützter Verfahren im Hardwaredesign. Hier ermöglichen generative Algorithmen eine automatisierte Variantenbildung, deren Ergebnisse auf vorliegenden Entwicklungsdaten basieren und nach bestimmten Optimierungskriterien bewertet werden. Durch den Einsatz von KI verkürzt sich nicht nur die iterative Phase der Prototypenentwicklung, sondern es wird auch eine kontinuierliche Rückkopplung zwischen Simulation und physikalischer Umsetzung etabliert. Ergänzend dazu können durch die Echtzeitanalyse von Fertigungsdaten sowohl maschinenbezogene als auch materialtechnische Parameter überwacht werden. Bei Abweichungen oder Ineffizienzen kann KI gezielte Anpassungsvorschläge generieren. Dieser adaptive Regelkreis trägt nicht nur zur Qualitätssicherung, sondern auch zur dynamischen Prozessoptimierung bei.
KI Use-Case 2: Effizienz steigern – Ressourcen besser einsetzen
Der zweite Anwendungsbereich adressiert das Ziel, mit weniger Ressourcen ein höheres Leistungsniveau zu erreichen. Hier entfaltet KI ihr Potenzial insbesondere in repetitiven, datenintensiven Verwaltungsprozessen. Durch den Einsatz natürlicher Sprachverarbeitung und regelbasierter Klassifikationssysteme lassen sich administrative Aufgaben wie das Erstellen von Management- und Qualitätsberichten, die Analyse von Lieferantendaten oder die automatische Dokumentation weitgehend automatisieren. Ebenso kann KI im Projektmanagement unterstützend wirken, etwa bei der Risikoanalyse, Meilensteinplanung oder der Priorisierung von Arbeitspaketen auf Basis dynamischer Datenmodelle.
Ein zusätzlicher Effizienzgewinn ergibt sich durch den Einsatz simulationsbasierter Verfahren, die physische Testläufe – etwa bei Hardwarekomponenten – ersetzen oder signifikant reduzieren können. Dies spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch Kosten im Testbetrieb erheblich.
Ein Beispiel aus der Produktion: Verbrauchsteile müssen regelmäßig geprüft werden. Bisher bedeutete das Rundgänge, Listen, Nachbestellungen. Oft zu spät oder zu viel. KI kann anhand von Verbrauchsdaten vorhersagen, wann Material nachbestellt werden sollte. Das spart Zeit, entlastet Mitarbeiter und senkt das Risiko von Fehlteilen.
KI Use-Case 3: Mehr Zeit für Innovation
Wie schaffen wir es den Menschen mehr Zeit für Innovation zu geben? Auch hier kann KI helfen. Besonders augenfällig wird dieser Effekt im Bereich der Softwareentwicklung. Fortschritte im Bereich der generativen KI, insbesondere bei großen Sprachmodellen (LLMs), erlauben mittlerweile eine weitreichende Automatisierung von Programmieraufgaben. In praxisorientierten Umfeldern können bereits heute zwischen 60 und 80 Prozent des Codes durch KI-generierte Vorschläge erstellt und nachfolgend von Entwicklern validiert und integriert werden.
Auch im Bereich des Debuggings sowie der automatisierten Testfallgenerierung lässt sich durch KI eine signifikante Entlastung erzielen. Die hierdurch gewonnene Kapazität kann gezielt in kundennahe Entwicklungsprojekte überführt werden, deren Umsetzung zuvor aufgrund begrenzter Ressourcen nicht realisierbar war. Diese strategische Hebelwirkung demonstriert, wie KI nicht nur bestehende Prozesse optimiert, sondern auch neue Geschäftspotenziale eröffnet.
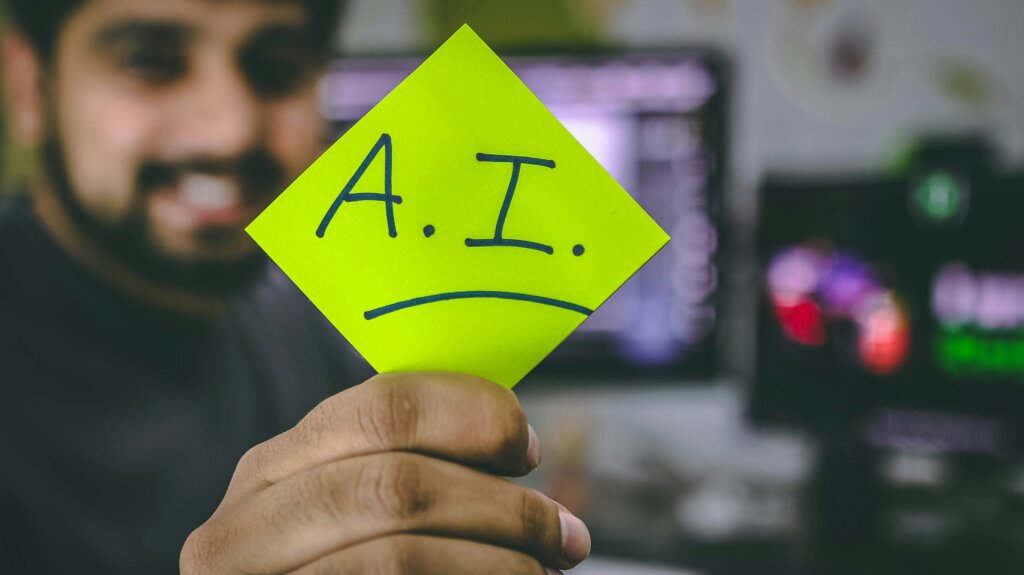
Quelle: Unsplash
10% Algorithmus, 20% Daten, 70% Organisationsentwicklung
Die obigen Beispiele zeigen das Potenzial des Einsatzes von KI für Unternehmen. Damit es eine Chance hat zu funktionieren, müssen sich Organisationen bewusst sein, dass die Integration von KI in Unternehmen weder ein reines IT-Vorhaben noch eine isolierte Effizienzmaßnahme darstellt.
Technik ist der kleine Teil der Veränderung
Die obigen Beispiele erfordern vielmehr strategische Klarheit und große Veränderungen der Organisation, sowohl der formalen als auch der informellen Strukturen, sowie der Steuerungslogiken des Unternehmens. Dabei ist auch zu erwarten, dass es in der Organisation zu Widerständen, Ängsten und Bedenken kommen wird. Menschen haben Angst, irrelevant zu werden, Bereichsleiter und Führungskräfte sorgen sich um den Verlust von Einfluss, der Betriebsrat wird vermutlich erst einmal auf die Gefahren der KI für Arbeitsplätze, und die Überwachung von Mitarbeitern hinweisen.
Damit am Ende die gewünschten Effekte eintreten, müssen in der Organisationen einige Veränderungen mit strategischer Klarheit initiiert werden. Es handelt sich also um einen Prozess der Organisationsentwicklung oder sogar Transformation. Dabei ist auch klar, dass sich die Veränderung von Organisationen eben genau nicht planen lässt wie die Einführung von KI-Tools. Im Gegenteil, wir müssen mit Gegenreaktionen der Organisation und der Menschen in der Organisation rechnen.
Die Chancen der KI können hier als Treiber oder Anlass für diese Veränderungen wirken.
Da „leider“ in vielen Organisationen zuerst einmal technisch betrachtet wird, möchten wir hier noch einmal betonen, dass die technische Umsetzung der kleine Teil der Veränderung sein wird. Die Einführung von KI berührt grundlegende Fragen formaler Organisationsstrukturen, wie Entscheidungs-kompetenzen und –prozesse und die Verteilung von Zuständigkeiten und Verantwortung.
Beispiel technisches Beratungsunternehmen
Ich (Florian Rustler) hatte kürzlich ein Gespräch mit dem Vertreter eines IT-nahen Beratungsunternehmens. Die Berater sind meist alle technische Experten, die IT und IoT-Lösungen bei Kunden aufsetzen. Man könnte meinen, dass diese technikaffinen Menschen den Einsatz von KI mit Interesse und Begeisterung vorantreiben. Das Gegenteil ist der Fall. Der Großteil der Gruppe ist KI gegenüber extrem skeptisch gegenüber eingestellt und hat kein Interesse hier „Experimente“ zu machen. Ob dieses Skepsis daher rührt, dass sie aufgrund ihrer technischen Expertise die KI-Versprechen als heiße Luft betrachten oder von einer diffusen Angst um ihre Jobs, konnte ich noch nicht herausfinden. Der Ansprechpartner vermutet letzteres. Es zeigt sich jedoch, dass das Unternehmen hier auf der Appell-Ebene nicht weiterkommen wird: „Probiert es doch mal aus!“ wird nicht reichen. Stattdessen wird es Änderungen an den formalen Strukturen benötigen, um ein anderes Handeln erwartbar zu machen. Es wäre z.B. denkbar den Beratern Ziele zu setzen, dass sie mit KI experimentieren müssen und jede Beraterin eine gewisse Anzahl von Experimenten nachweisen muss. Bei der stark ausgeprägten anti-autoritären Kultur des Unternehmens ist jedoch bei dieser Maßnahmen mit verschiedensten Gegenreaktionen zu rechnen. Das Beispiel zeigt exemplarisch, dass der Einsatz von KI Veränderungen auf Seite der Organisation erfordert und es sich damit um einen Organisationsentwicklungsprozess handelt.
Jeder der obigen Use-Cases erfordert spezifische organisatorische Anpassungen, etwa in Form von Prozessautomatisierung, veränderten Steuerungslogiken oder dem Aufbau neuer Kompetenzen. Zwar lassen sich diese Pfade grundsätzlich parallel verfolgen, ihre Wirksamkeit hängt jedoch maßgeblich davon ab, inwieweit sie aufeinander abgestimmt und in eine konsistente Transformationsvision eingebettet sind.

Quelle: Unsplash
KI als integraler Bestandteil der Wertschöpfung
Der nachhaltige Mehrwert von KI entfaltet sich erst dann, wenn technologische Innovation, menschliche Kompetenzentwicklung und strukturelle Erneuerung kohärent zusammen gedacht und implementiert werden. Dies setzt voraus, dass KI nicht als externes Add-On, sondern als integraler Bestandteil der Wertschöpfungsprozesse begriffen wird. Nur wenn Mitarbeiter befähigt werden, KI-Systeme kompetent und verantwortungsvoll zu nutzen, und wenn Entscheidungsprozesse, Zuständigkeiten und organisatorische Strukturen an die durch KI veränderten Anforderungen angepasst werden, kann das transformative Potenzial dieser Technologie voll ausgeschöpft werden.
Vorteil für junge Unternehmen
Während junge Unternehmen in der Lage sind, ihre Prozesse und Strukturen von Beginn an datengetrieben und KI-kompatibel zu gestalten, stehen etablierte Organisationen vor der Herausforderung, auf jahrzehntelang gewachsene, primär auf menschliche Arbeitskraft und sequenzielle Entscheidungslogik ausgerichtete Systeme zurückzugreifen. Die Integration von KI erfordert daher eine strukturelle Reorganisation, die weit über technologische Aspekte hinausgeht. Auch bestätigt sich noch einmal, dass die für das Funktionieren von KI notwendige Organisationsentwicklung die größere Herausforderung darstellt.
Änderungen auf Seiten der formalen Strukturen einer Organisation lassen (Gegen-)Reaktionen und Ausweichbewegungen auf der informellen Seite erwarten. Wie genau diese ausfallen lässt sich vorher nur begrenzt prognostizieren und hängt vom konkreten Kontext, der Kultur und der Historie des Unternehmens hat.
Start mit einer Analyse des Geschäftsmodells
Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse ist eine strategisch fundierte Analyse des Geschäftsmodells unabdingbar, um überhaupt eine Vorstellung davon zu bekommen, wo KI sinnvoll zum Einsatz kommen könnte. Ziel dieser Analyse ist es, strukturelle Schwachstellen (Pain Points) ebenso wie ungenutzte Potenziale (Opportunities) zu identifizieren. Eine bewährte Methodik zur systematischen Erfassung dieser Faktoren stellt die SWOT-Analyse dar. Diese erlaubt eine strukturierte Bewertung von Stärken (Strengths), Schwächen (Weaknesses), Chancen (Opportunities) und Risiken (Threats), die als Ausgangspunkt für die Priorisierung von KI-Anwendungsfeldern dienen kann. Entscheidend ist dabei nicht nur die technische Umsetzbarkeit, sondern insbesondere der strategische Hebel, den eine KI-gestützte Lösung im Hinblick auf Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz und Innovationskraft bieten kann.
Fazit
KI kann Prozesse optimieren, Innovation fördern und Wachstum antreiben. Aber nur, wenn Technik, Kompetenzen und Strukturen zusammenspielen. Die nicht-technischen Aspekte werden dabei eine nicht berechenbare Eigendynamik entwickeln.
Binden Sie die Menschen früh in den Veränderungsprozess ein und erwarten sie gleichzeitig Widerstände, mit denen Sie umgehen müssen. So erhöht sich die Chance, dass KI nicht zum Fremdkörper wird, sondern zum Motor einer Transformation.